Hamburg. Abendblatt-Reporterin hat sich mit Covid-19 infiziert und darf ihre Wohnung nicht verlassen. So ändert sich das Familienleben.
Reportage
Corona: Was die Quarantäne mit einer Hamburger Familie macht
•
Lesezeit: 15 Minuten
Von Yvonne Weiß
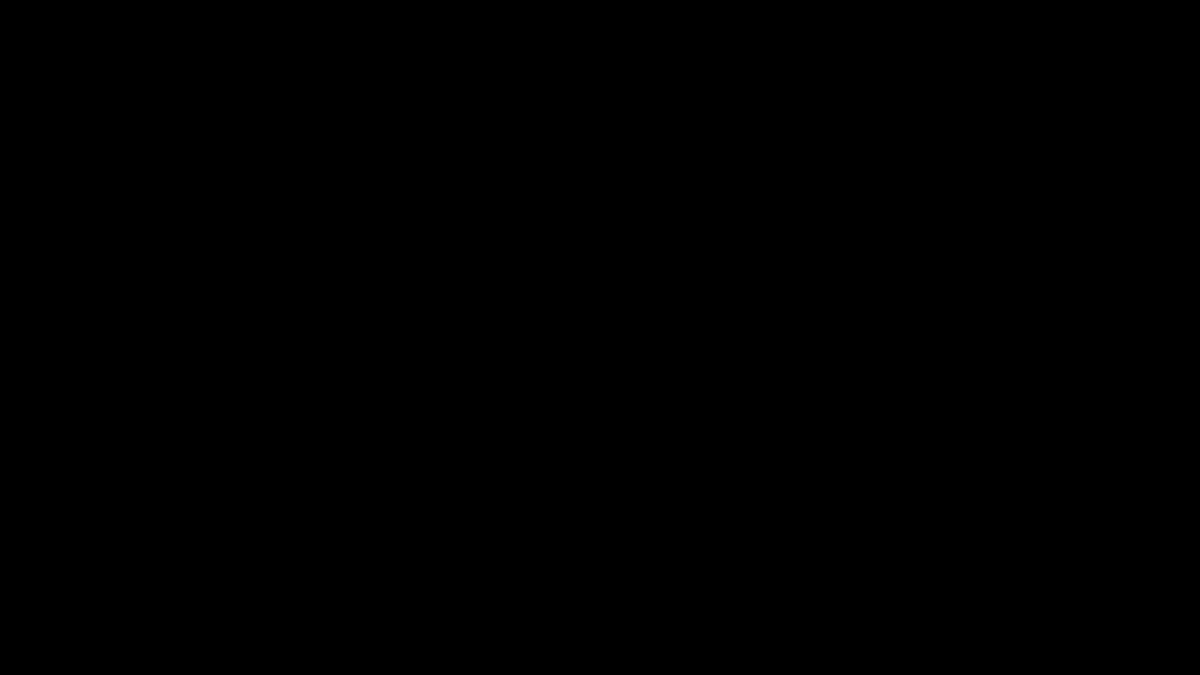
Szenen einer Quarantäne. Unsere erkrankte Reporterin Yvonne Weiß mit ihren Kindern Minna und Jesse.
© Yvonne Weiß | Yvonne Weiß


