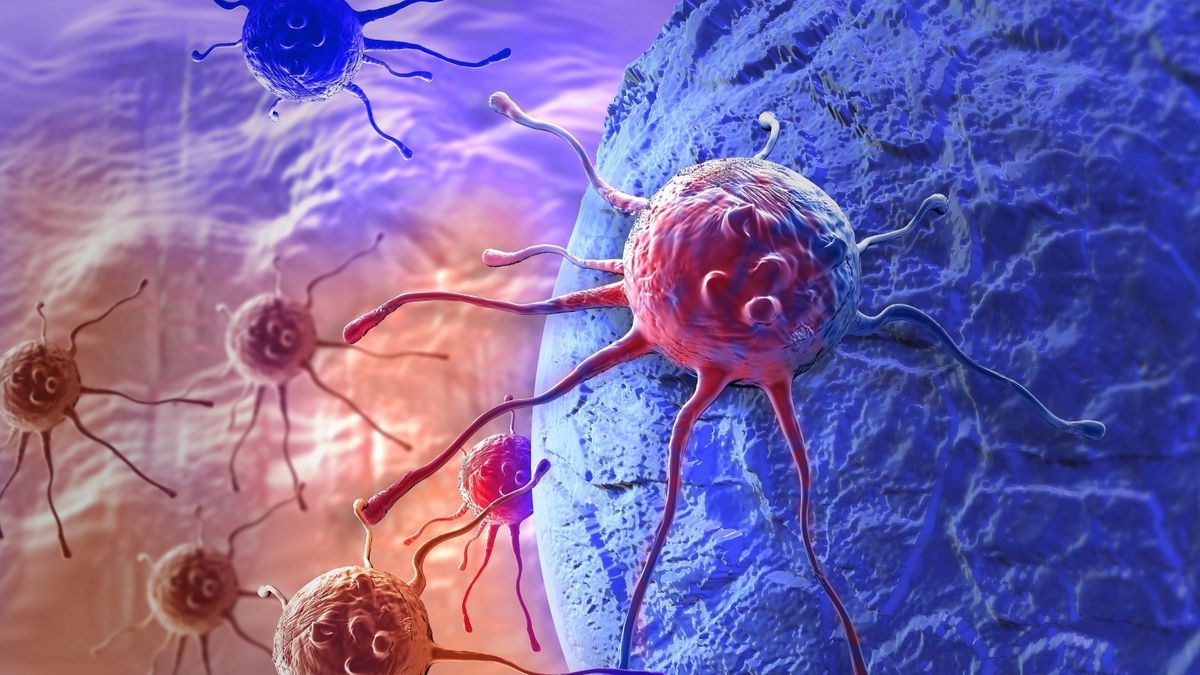Baltimore/Heidelberg. US-Forscher haben eine neue Studie veröffentlicht. Demnach beruhen zwei Drittel aller Tumore auf Fehlern bei der Stammzellenteilung.
Schon die erste Studie zu dem Thema führte zu hitzigen Debatten: Vor zwei Jahren berechneten zwei Mediziner anhand von US-Daten, dass das Krebsrisiko eines Menschen stärker vom Zufall abhängt als von seinem Erbgut und seiner Umwelt. Nun bestätigen Cristian Tomasetti und Bert Vogelstein von der Johns Hopkins University in Baltimore (USA) auf weltweiter Datenbasis, dass zwei Drittel aller Krebsmutationen auf Fehlern bei der Teilung von Stammzellen beruhen. In der Zeitschrift „Science“ betonen sie jedoch, der Einfluss der Lebensweise auf das Tumorrisiko sei für manche Krebsarten durchaus beträchtlich – insbesondere von Lunge, Haut und Speiseröhre.
„Es ist bekannt, dass wir Umweltfaktoren wie Rauchen vermeiden müssen, um das Krebsrisiko zu senken“, wird der Biostatistiker Tomasetti in einer Mitteilung seiner Universität zitiert. „Weniger bekannt ist, dass eine normale Zelle, die sich teilt und ihre DNA kopiert, jedes Mal mehrere Fehler macht. Diese Kopierfehler sind eine bedeutende Quelle von Krebsmutationen, die historisch unterschätzt wird.“ Mutationen in Stammzellen werden mitunter an Milliarden Tochterzellen weitergegeben und können so die Saat für einen späteren Tumor legen.
Vergleich mit Krebsregistern aus 69 Ländern
Pro Zellteilung, bei der die rund 3,3 Milliarden Basenpaare der DNA kopiert werden, komme es rechnerisch zu etwa drei Kopierfehlern, schreiben die Forscher. Um zu errechnen, welchen Anteil diese zufälligen Mutationen an Krebs haben, untersuchten sie zunächst die Zahl der Stammzell-Teilungen bei 17 Krebsarten. Dies verglichen sie mit der Häufigkeit der jeweiligen Tumore anhand von Krebsregistern für 69 Länder, in denen zwei Drittel der Weltbevölkerung leben. Zudem berücksichtigten sie epidemiologische Daten. Dabei fanden sie einen deutlichen Zusammenhang: Tumore treten vor allem in Gewebetypen mit vielen Stammzell-Teilungen auf.
Für alle Krebsarten gemittelt, so kalkuliert das Team, resultieren 66 Prozent der Tumormutationen aus zufälligen Kopierfehlern, 29 Prozent basieren auf Umwelteinflüssen wie etwa Lebensstil und fünf Prozent gehen auf Erbfaktoren zurück. Allerdings variiert das Bild je nach Krebsart stark.
Zellteilungsfehler machen 95 Prozent aus
Bei Tumoren von Prostata, Gehirn und Knochen beruhen demnach 95 Prozent der Mutationen auf zufälligen Fehlern, bei der Bauchspeicheldrüse 77 Prozent. Anders bei Lungenkrebs: Dort stellen Umweltfaktoren wie besonders das Rauchen etwa 65 Prozent der Mutationen, aber selbst hier machen zufällige Kopierfehler noch 35 Prozent aus.
Meist müssen mehrere Mutationen zusammenkommen, ehe ein Tumor entsteht. Daher könne der Prozentsatz der verhinderbaren Krebserkrankungen höher liegen als der der zufälligen Mutationen, merken die Forscher an. Epidemiologischen Berechnungen zufolge sind etwa 40 Prozent der Tumore vermeidbar. Dies halten die Forscher für möglich, schließlich könne eine umweltbedingte Mutation letztlich den Ausschlag geben, ob Krebs entsteht oder nicht. „Unsere Studien widersprechen der klassischen Epidemiologie nicht, sie ergänzen sie eher“, schreibt das Team.
Die Erkenntnis kann Trost bieten
Im Gegensatz zu Lungenkrebs sei der Einfluss der Umwelt auf Tumore von Gehirn, Knochen und Prostata sehr gering. „Solche Tumore werden immer auftreten, egal wie perfekt die Umwelt ist“, sagt der Onkologe Vogelstein. Das könne jenen Menschen Trost bieten, die trotz gesunder Lebensführung an Krebs erkranken. „Es ist nicht Ihre Schuld“, betont Vogelstein. „Hinter der Krankheit steckt nichts, was Sie getan oder nicht getan haben.“
Grundsätzlich empfehlen die Forscher zwei Formen der Krebsprävention: Bei jenen Tumorarten, bei denen die Umwelt eine wichtige Rolle spielt, solle man Tipps zur Vorbeugung geben. Bei den anderen Tumoren, die vor allem vom Zufall abhängen, sei dagegen eine gute Früherkennung gefragt.
Die meisten Mutationen sind wahrscheinlich folgenlos
„Ein Verständnis des Krebsrisikos, das Pech ignorieren würde, wäre ebenso unangebracht wie eines, das Umwelt- und Erbfaktoren nicht berücksichtigen würde“, schreibt Martin Nowak von der Harvard University in einem „Science“-Kommentar. „Die frühere Analyse von Tomasetti und Vogelstein hat schon viele Diskussionen verursacht, und die neuen Resultate werden das ebenfalls tun. Die Ergebnisse zeigen einen eindeutigen Bedarf, Krebs mathematisch präzise zu verstehen.“
Darauf verweist auch Andreas Trumpp vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. „Mathematisch verstehen wir die Entwicklung eines Tumors im Detail noch nicht“, sagt der Direktor des Heidelberger Stammzellinstituts HI-STEM. „Dazu ist die Datenlage bisher zu dünn.“ Dennoch weise die Studie mit ihrer sehr großen Datenbasis darauf hin, dass die Zahl der Stammzell-Teilungen das Krebsrisiko stark beeinflusst.
„Die allermeisten Mutationen spielen wahrscheinlich keine Rolle“, erläutert Trumpp. „Aber wenn die Mutation einer Stammzelle ein wichtiges Gen betrifft, wird sie möglicherweise an Milliarden Nachkommen lebenslang weitergegeben und kann die Saat für eine Krebserkrankung bilden.“ Wie groß die Rolle von Umwelt, Erbfaktoren und Zellteilungen sei, hänge letztlich von der Tumorart ab.